Ich starre aus dem Bürofenster des Therapeuten auf meinen Minivan auf dem Parkplatz – den Minivan, den ich nie wollte. Mein Mann sitzt neben mir und schaut in die entgegengesetzte Richtung, obwohl ich mir sicher bin, dass er genauso starrt wie kurz zuvor. Ich kann es ihm nicht verübeln, wirklich. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass deine Frau dir sagt, dass deine scheinbar glückliche Ehe nur einseitig ist.
Rückblickend schiebe ich alles auf den roten Samtkuchen, den er ein paar Wochen zuvor zu meinem Geburtstag gekauft hatte. Ich hasse roten Samtkuchen, ungefähr so sehr wie ich Musik mit Banjos oder Slapstick-Komödien hasse. Deshalb konnte ich auch nicht glauben, dass mein Mann das nach sieben Jahren Ehe nicht wusste. Ich habe es natürlich trotzdem gegessen, weil ich seine Gefühle nicht verletzen wollte. Und wie immer ging ich an diesem Abend zu Bett, ohne ein Wort darüber zu verlieren.
Am nächsten Morgen fühlte sich alles falsch an, als ob ich den Traum eines anderen lebte, außerhalb meines Körpers schwebte und mich selbst dabei beobachtete, wie ich die Handlungen eines Lebens durchführte, das ich nicht wollte (metaphorisch, wie ich meinem Psychiater einmal versicherte). Wir lebten dort, wo ich nicht leben wollte, in einem Haus, das ich nicht bauen wollte, mit einem Auto in der Garage, das ich nie kaufen wollte. Nichts war meine Wahl, nicht einmal mein Geburtstagskuchen, anscheinend, und alles war die Schuld meines Mannes.
„Wir lebten dort, wo ich nicht leben wollte, in einem Haus, das ich nicht bauen wollte, mit einem Fahrzeug, das ich nie kaufen wollte.“

Die nächsten Wochen gerieten die Dinge schnell außer Kontrolle. Meine Kinder nennen das „die Zeit, in der Mama wegging“, obwohl ich physisch nirgendwo hingegangen war. Ich habe viel geschrien, und wenn ich nicht geschrien habe, habe ich geweint. Und dann kam das Schweigen, die leeren Blicke, die Hoffnungslosigkeit. Am Rande der Trennung bot mein Mann einen letzten Versuch an – eine Eheberatung.
Womit ich wieder bei Jean bin, unserer Therapeutin. „Wie wäre es nächsten Dienstag um 11 Uhr?“, fragt sie.
Mein Mann schaut auf sein Telefon und überprüft den Arbeitsplan, der immer vor mir kommt. „Können wir stattdessen 13 Uhr machen? Ich bin zum Mittagessen verabredet.“
Ich rolle mit den Augen. Natürlich tut er das.
„Eigentlich“, antwortet sie. „Ich würde mich gerne eine Weile mit Jenna treffen, wenn das okay ist.“
Ich erwidere ihren Blick und bin ein wenig überrascht. „Warum?“

„Weil wir nicht daran arbeiten können…“, sagt sie und zeigt zwischen meinem Mann und mir hin und her, „…bis wir an dir arbeiten. Ich denke auch, dass es eine gute Idee wäre, wenn Sie einen Termin für ein psychologisches Gutachten vereinbaren würden. Ich kann Sie an jemanden verweisen, wenn Sie das möchten.“
Ich starre ungläubig, die Hitze steigt mir in die Wangen, dann schüttle ich den Kopf. Ich war schon einmal hier und weiß, was es bedeutet – sie denkt, ich brauche Medikamente. Ich fühle mich genauso wie damals – beleidigt, schwach, als würde ich mich am liebsten unter einen Stein verkriechen. Sehen Sie, das ist der Scheiß, den die Gesellschaft uns über Depressionen beibringt – dass es etwas ist, das man verstecken muss, etwas, das man leugnen muss, etwas, wofür man sich schämen muss. Das ist der Grund, warum so viele Menschen unbehandelt bleiben und warum Depressionen so viele Leben zerstören. Deshalb habe ich meinem Mann die Schuld an meiner Unzufriedenheit gegeben, anstatt mir einzugestehen, dass ich Hilfe brauchte, und meine Ehe wäre fast daran zerbrochen.
Natürlich wurde mir das erst Monate später klar, nachdem ich mich an das Zoloft gewöhnt hatte und eine Zeit lang zu Jean gegangen war.
Wenn man noch nie unter Depressionen gelitten hat, ist das schwer zu verstehen. Manche halten es für eine große Farce, wie Kornkreise oder Heaven’s Gate. Manche halten es für ein Wort, das Menschen als Sündenbock benutzen, um schlechte Entscheidungen zu rechtfertigen. Und manche glauben, dass man sich einfach selbst dazu bringen kann, wieder glücklich zu sein, oder dass man nur eine kleine Perspektive braucht, um das Licht zu sehen. Das war bei mir der Fall. Ich hatte Freunde und Verwandte, die sagten: „Warum bist du so unglücklich? Sieh dir doch an, wie verkorkst mein Leben ist.“ Oder: „Medikamente? Du brauchst keine Medi-kation! Was du brauchst, ist ein schöner, langer Urlaub, um von allem wegzukommen.“
Nun, danke für den Ratschlag, Einstein, aber wenn es so einfach wäre, mich aus dem Nebel zu ziehen, hätte ich die Flugtickets schon vor Monaten gekauft.
„Die Gesellschaft lehrt uns, dass Depressionen etwas sind, das man verstecken muss, etwas, das man verleugnen muss, etwas, wofür man sich schämen muss.“

Denn genau das ist Depression – in einem endlosen, dichten, lähmenden Nebel zu stehen. Man weiß, dass man sich verirrt hat und möchte einen Ausweg finden, aber man kann in keine Richtung sehen, also bewegt man sich nicht. Du spürst, wie sich die Welt um dich herum dreht und weitergeht, aber sie ist zu schnell, um sie zum Stillstand zu bringen, also stehst du weiter still. Je länger du dort stehst, desto dichter wird der Nebel, desto schneller dreht er sich, und nach einer Weile ist es dir einfach egal. Um alles. Dann fängst du an, dich im Nebel wohl zu fühlen. Es ist einfacher. Du verstehst ihn und er versteht dich. Dort zu bleiben ist weit weniger beängstigend als die Konfrontation mit dem, was einen auf der anderen Seite erwartet.
Zumindest fühlte es sich für mich so an.
Ich hatte gehofft, wie die meisten Menschen, die unter Depressionen leiden, dass die Medikamente alles verschwinden lassen würden, aber das war nicht der Fall. Ich verglich es mit der Einnahme von Stadol während der Geburt – es nimmt einem nicht den Schmerz, es lindert ihn nur soweit, dass man sich konzentrieren kann. Das Zoloft ließ den Nebel nicht verschwinden, es verdünnte ihn nur soweit, dass ich einen Ausweg sah. Es würde einige Zeit dauern, ihn zu erreichen, aber ich war ja auch nicht über Nacht hierher gekommen, wie ich es mir einmal eingeredet hatte. Es war Teil eines viel größeren Problems – eines tiefer verwurzelten Problems – das lange vor dem Stück roter Samttorte begann.
Ich war einsam – schrecklich einsam – und ich glaubte wirklich, dass es daran lag, dass ich nicht liebenswert war.
Ich konnte es niemandem verübeln, wirklich nicht. Ich mochte mich selbst auch nicht besonders. Ich war ein Freak, ein Angeber, ein Feigling der schlimmsten Sorte. Ich bin das Mädchen, das in einem Raum voller Leute sitzt und betet, dass jemand kommt, um Hallo zu sagen, aber niemand tut es, weil sie mein panisches Schweigen für Arroganz halten. Ich hatte mich zu der Art von Frau entwickelt, von der ich mir geschworen hatte, dass ich nie eine werden würde – eine, die nie etwas sagt, ihre Meinung vertritt oder ihren Standpunkt vertritt. Zehn Jahre lang hatte ich mich hinter der bequemen Mauer meiner Introvertiertheit versteckt, und jetzt war sie so hoch, dass ich nicht hindurchsehen und nicht hindurchklettern konnte.
Ich hatte diese Dinge getan, niemand sonst. Und ich hasste mich selbst dafür.
Erst als ich dies laut aussprach, konnte ich anfangen, etwas davon in Ordnung zu bringen. Ich verbrachte die nächsten Monate damit, zu verstehen, warum ich so fühlte, und zu lernen, wer ich wirklich war und sein wollte. Ich fing wieder an zu schreiben, töpferte jeden Freitagabend mit einer Arbeitskollegin und versuchte, trotz meiner Introvertiertheit aktiv Leute zu treffen. Jean gab mir kleine Aufgaben mit auf den Weg, wie z. B. allein Pizza zu bestellen (ja, so introvertiert war ich), meinem Mann zu sagen, dass ich mir seit Monaten einen neuen Computer wünschte, und kleinere Entscheidungen wie das Sommerlager für die Mädchen ohne ihn zu treffen. Und obwohl ich befürchtet hatte, dass ihn das alles verärgern würde, bewirkte es genau das Gegenteil. Er war sehr dankbar, unterstützte mich und gab mir gerne Ratschläge, wenn ich ihn darum bat. Aber letzten Endes musste ich alle Entscheidungen selbst treffen. Das war schon immer so, ich konnte es nur nicht sehen.
„Ich hatte gehofft, dass die Medikamente alles verschwinden lassen würden, aber das taten sie nicht.“

Jahre sind nun seit meiner Wiedergeburt vergangen. Wir wohnen immer noch im selben Haus, haben die gleiche Anzahl von Kindern, und der Minivan steht immer noch in der Einfahrt (obwohl ich jetzt auch einen SUV habe). Ich sehe Jean immer noch gelegentlich, wenn ich sie brauche, und ich nehme das Zoloft immer noch täglich. Ich habe einmal versucht, es abzusetzen, aber die Dinge gerieten schnell wieder außer Kontrolle. Also habe ich gelernt, es zu akzeptieren, wie jedes andere Medikament, das ich gegen schlechte Cholesterinwerte oder hohen Blutdruck einnehmen würde. Ich werde nie das Mädchen sein, das aus der Geburtstagstorte springt, aber ich lasse mich von meiner Introvertiertheit nicht davon abhalten, die Dinge zu tun, die ich liebe. Ich bin meine eigene Person, die sich nicht nur als Ehefrau oder Mutter definiert, und mein Mann und ich sind stärker als je zuvor.
Manchmal frage ich mich, ob es für ihn so war, als würde er all die Monate mit einem Fremden zusammenleben. Ich frage mich, ob es jemals einen Moment gab, in dem er sich Sorgen machte, dass er die Person, zu der ich wurde, nicht lieben könnte. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Antwort darauf wissen will. Stattdessen danke ich einfach meinen Glückssternen, dass ich Hilfe bekommen habe, als ich es tat, und dass mein Mann geblieben ist.
Ich danke meinen Glückssternen, dass ich noch nicht zu weit gegangen war, um zuzugeben, dass die Bruchlinien in meiner zerbrechenden Ehe mir gehörten.
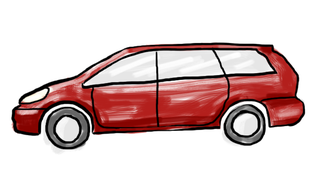
Jenna Patricks Debütroman, DIE REGELN DER HALBEN, beschäftigt sich mit psychischen Erkrankungen in einer Kleinstadt. Sie lebt mit ihrer Familie in North Carolina.